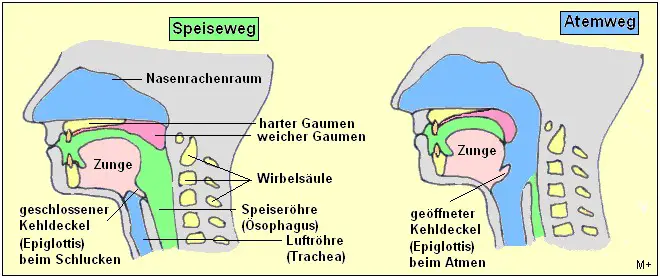Anatomie der Speiseröhre |
|
Inhaltsübersicht
|
Top |
|
Verlauf der Speiseröhre
|
|
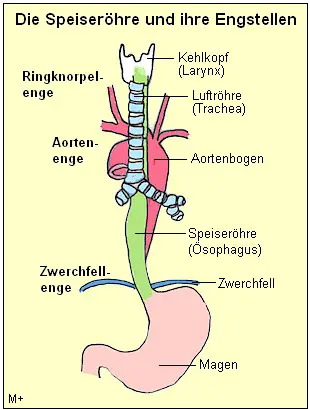 |
Die Speiseröhre wird im medizinischen Fachjargon Ösophagus genannt und
ist der Transport- und Verbindungsweg zwischen Rachen und Magen. Sie ist ein elastischer,
etwa 25 cm langer, Muskelschlauch mit einer durchschnittlichen Weite von etwa 2 cm. Beim
Schlucken von Speisen oder Flüssigkeiten kann sie sich jedoch auf bis zu 3,5 cm Weite
aufdehnen. In ihr finden keine Verdauungsvorgänge statt, sie dient ausschließlich als
Transportweg. Die Speiseröhre befindet sich zwischen Luftröhre und Wirbelsäule, wobei
sie sich im weiteren Verlauf nach unten, zum Magen hin, von der Wirbelsäule entfernt. Die Weite der Speiseröhre ist nicht über ihre ganze Länge gleich. Auf ihrem Weg zum Magen muss die Speiseröhre drei anatomisch bedingte Engstellen passieren: die erste Enge wird durch den Kehlkopf verursacht. Sie ist von allen die engste Stelle und die am wenigsten erweiterungsfähige. Auf dem weiteren Weg nach unten verengt dann als nächstes die Aorta die Speiseröhre, weshalb diese Stelle auch als Aortenenge bezeichnet wird. Die letzte Enge besteht beim Durchtritt durch das Zwerchfell. An diesen drei Stationen kann sich die Speiseröhre bei Nahrungsaufnahme nicht so weit ausdehnen, wie an ihren anderen Stellen. Sie behält dort ihre Weite von etwa 2 cm konstant bei. Normalerweise bleiben diese Engpässe unbemerkt. Es gibt aber Situationen, in denen sich die Engstellen bemerkbar machen, z. B. wenn jemand zu hastig zu viel Nahrung auf einmal herunterschluckt oder die Nahrung nur ungenügend gekaut wird. Es besteht aber dann trotzdem kein Grund zur Besorgnis, da der Speisebrei nach kurzem Stocken auch schnell wieder weiter Richtung Magen befördert wird. Nur die nächsten Bissen sollten dann wieder etwas kleiner ausfallen.
|
Engstellen werden besonders belastet |
Durch die besonderen Belastungen an diesen natürlichen Engstellen ist
jedoch das Risiko erhöht, hier Entzündungen oder Tumoren zu entwickeln.
|
Top |
|
Wandaufbau der Speiseröhre
|
|
Die Muskelschicht des Speiseröhre ist in einen willkürlichen und unwillkürlichen Bereich unterteilt |
Die Wand der Speiseröhre besteht aus vier unterschiedlichen Schichten:
|
Schließmuskeln verhindern den Rückfluss der Nahrung |
Am oberen und unteren Ende der Speiseröhre befindet sich jeweils ein
Verschlussmechanismus: der obere und untere Ösophagussphinkter. Die Muskulatur dieser
beiden Verschlüsse steht hier unter einem höheren Tonus als die Wandmuskulatur im
übrigen Teil der Speiseröhre. Die verstärkte Spannung der Muskulatur sorgt an diesen
Stellen für den nötigen Verschluss zum Rachen und Magen hin. Im Bereich des unteren
Ösophagussphinkters geht die Speiseröhre in den Magen über. Deshalb wird dieser Bereich
auch oft als Magenmund oder Kardia bezeichnet. "Unterer Ösophagussphinkter",
"Magenmund" und "Kardia" sind synonym verwendete Begriffe. Der
Magenmund liegt etwa 1 bis 4 cm unterhalb des Zwerchfells.
|
Top |
|
Der Vorgang des Schluckens
|
|
Durch eine bewusste Bewegung der Zunge wird der Schluckakt eingeleitet |
Bevor die Nahrung heruntergeschluckt werden kann, muss sie gründlich
gekaut und mit Speichel vermischt werden. Die Zunge formt daraufhin einen Bissen (Bolus),
der durch seine Form leicht die Speiseröhre hinuntergleiten kann. Der Speisebrei ist
jetzt schluckfertig gemacht worden. Durch eine bewusste Bewegung der Zunge wird der
Schluckakt eingeleitet. Der obere Ösophagussphinkter erschlafft beim Schlucken, um der
Speise den Durchtritt zu gewähren. Zu Beginn, in der oralen Phase, ist dieser Vorgang
noch willkürlich steuerbar. Die Nahrung wird bewusst heruntergeschluckt. Sobald sie
jedoch den Zungengrund und damit den Rachen (Pharynx) erreicht, hat der Mensch keine
Gewalt mehr über den Schluckvorgang. Das vegetative Nervensystem übernimmt jetzt alle
weiteren Funktionen. Ab dieser pharyngealen Phase geschieht nun alles nur noch rein
reflektorisch.
|
Der Kehldeckel verschließt beim Schlucken die Luftröhre |
Damit es nicht zum Verschlucken kommt und die Nahrung tatsächlich den
richtigen Weg findet, sind Schluckvorgang und Atmung genau aufeinander abgestimmt. So
verschließt der Kehldeckel (Epiglottis) die Luftröhre (Trachea) beim Schlucken, indem er
sich nach unten bewegt und die Luftröhre abdichtet. Auf diese Weise kann nichts an
Speisen oder Flüssigkeiten in die Luftröhre gelangen. Obwohl dieser Mechanismus
reflexartig geschieht, passiert es aber trotzdem manchmal, dass er etwas verspätet
einsetzt, z.B. wenn die Koordination zwischen Schluckvorgang und Atmung durch Sprechen
oder plötzliches Lachen aus dem Takt gerät. Man "verschluckt" sich: Jetzt
können kleine Mengen an Flüssigkeit oder fester Nahrung in den Kehlkopf gelangen. Sofort
führt dieser Kontakt reflexartig zu einem Verschluss der Stimmlippen und unwillkürlich
treten starke Hustenstöße auf. Durch die Kraft des Hustens werden die Fremdkörper aus
dem Kehlkopf heraus befördert und der Atemweg ist wieder frei.
|
Das Gaumensegel versperrt den Weg nach oben |
Auch der obere Bereich, der Nasen- und Rachenraum, wird beim Schlucken
abgedichtet. Dabei hebt sich das Gaumensegel (weicher Gaumen) nach oben an und die
Rachenwand zieht sich zusammen. Auf diese Weise ist auch der Weg nach oben abgedichtet und
es kann keine Speise oder Flüssigkeit ungewollt in den Nasen-Rachenraum gelangen.
|
Top |
||
Transport der Nahrung
|
||
Der Transport der Nahrung ist ein aktiver Prozess |
Auf seinem weiteren Weg Richtung Magen wird der Nahrungsbrei
mit Hilfe der Muskulaturschichten (vlg. Wandaufbau
der Speiseröhre) transportiert. Dies geschieht innerhalb von 6 bis 8 Sekunden durch
wellenförmige Kontraktionen der Muskulatur in Richtung Magen. Diese Art der Fortbewegung
der Speise nennt sich Peristaltik. Dabei kontrahiert die Muskulatur hinter dem Speisebrei
und drückt ihn nach unten. Gleichzeitig erschlafft die davor gelegene Muskulatur
reflektorisch. So geht es abwechseln - kontrahierend und erschlaffend - weiter, bis der
Magen erreicht ist. Der Transport der Nahrung vom Rachen in den Magen ist wegen dieser
Muskelarbeit ein aktiver Prozess. Diese Unterscheidung ist wichtig. Sie könnten sogar auf
dem Kopf stehend essen. Die Nahrung würde nach dem Schlucken dennoch in den Magen
transportiert werden.
|
|
Der Rückfluss wird verhindert |
Kommt der Nahrungsbrei schließlich am unteren
Ösophagussphinkter an, öffnet sich dieser ebenfalls durch Minderung des Tonus: Er
erschlafft und dem Eintritt in den Magen steht nichts mehr im Wege. Ist die Nahrung im
Magen angekommen, erhöht sich die Spannung des Sphinkters sich wieder, so dass der
Mageninhalt nicht zurück in die Speiseröhre gelangen kann. Ein Zurückfließen wird
zusätzlich verhindert, weil an dieser Stelle durch den Zwerchfelldurchtritt die
Speiseröhre verengt ist. Auch kann es aufgrund der Kontraktionen der bis auf 3 cm langen
Verdickung der Ringmuskulatur nur schwer zu einem Rückfluss des Mageninhaltes kommen.Top |
|
Zur Übersicht
|
Zur Übersicht
|
|