|
|
Operationen bei Halswirbelsäulenverletzungen mit Zugang von vorne
|
|
|
|
Lagerung und Fixierung
|
Der Kopf muss sicher gelagert sein
|
Bei Halswirbelsäulenoperationen mit einem Operationszugang von vorne
(ventral)
liegt der Patient auf dem Rücken. Um eine stabile Lage der Halswirbelsäule
während der Operation zu gewährleisten, wird der Kopf in einer gepolsterten
Kopfschale gelagert. Alternativ ist die Fixierung des Kopfes in einem Metallring
(Halo-Ring) oder in einer Metallzange möglich (Crutchfield-Zange oder
Gardner-Wells-Zange). Dazu ist es erforderlich, Befestigungsschrauben im
Schädelknochen zu verankern. Mithilfe von Halo-Ring, Crutchfield-Zange oder
Gardner-Wells-Zange lässt sich auch eine instabile
Halswirbelsäulenverletzung im Zeitraum zwischen der Verletzung und der Operation
in einer stabilen Position zu fixieren.
|
Schulter wird nach unten gezogen
|
Bei Operationen im unteren Abschnitt der Halswirbelsäule können die Schultern
im Weg sein, insbesondere bei erforderlichen Röntgenaufnahmen während des
Eingriffs. Um das zu vermeiden, werden die Schultern bei der Lagerung des
Patienten durch spezielle Zugsysteme nach unten gezogen (beispielsweise durch
Anbringen breiter Pflasterstreifen). |
|
Zugang zur Wirbelsäule
|
Hautschnitt rechts oder links von der Halsmitte
|
Die Operation beginnt mit dem Hautschnitt. Dieser verläuft quer auf der Höhe
der Wirbelsäulenverletzung. Er befindet sich bei rechtshändigen Operateuren an
der rechten Halsseite, bei linkshändigen Chirurgen entsprechend links. Bei
Operationen im unteren Halswirbelsäulenbereich - am Übergang zur
Brustwirbelsäule - liegt der Hautschnitt allerdings so gut wie immer auf der
linken Halsseite, um eine Verletzung des Rekurrens-Nervs zu vermeiden. Dieser
Nerv verläuft auf der linken Körperseite anders, als auf der rechten Seite. Durch den unterschiedlichen Verlauf ergibt sich auf der linken Seite ein
günstigerer Zugangsweg zur Halswirbelsäule. Der Rekurrens-Nerv versorgt einige
Muskeln des Kehlkopfes mit Nervenimpulsen. Seine Beschädigung kann zu
Stimmstörungen und - bei beidseitiger Beschädigung - zu Atemproblemen führen.
|
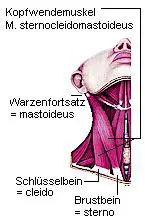
|
Als nächster Operationsschritt werden das Unterhautfettgewebe und das
sogenannte Platysma durchtrennt. Das Platysma ist ein direkt unter der Haut
liegender, flächiger Muskel, der bei starker Anspannung am Hals sichtbar wird
(Männer spannen ihn mitunter zur Erleichterung der Rasur bewusst an). Daran
anschließend durchtrennt der Chirurg die äußere Halsfaszie. Dabei handelt es
sich um die äußere Sehnenhülle der Halsmuskulatur. Der Schnitt zur
Fasziendurchtrennung folgt dem Verlauf des Halswendemuskels (Musculus
sternocleidomastoideus). Dieser verläuft zwischen dem hinter dem Ohr gelegenen Mastoid und dem Gelenk zwischen Schlüssel- und Brustbein, er spannt sich bei der
Kopfwendung an und wird dann gut sichtbar.
|
Stumpfes Verlagern von Blutgefäßen, Nerven und Muskeln
|
Nach der scharfen Durchtrennung der verschiedenen Gewebeschichten schließt
sich ein Operationsschritt mit sogenannter stumpfer Präparation an. Darunter
versteht man das Vordringen zum Operationsgebiet ohne Verwendung scharfer
Instrumente (beispielsweise mit stumpfen Instrumenten oder aber auch mit den
Fingern). Innerhalb der mittleren Halsfaszie (mittlere Sehnenhülle der
Halsmuskulatur) werden auf diese Weise die dort gelegenen Blutgefäße und Nerven
aufgesucht, die in einem Bündel zusammengelagert sind. Als Nächstes lockert der
Operateur das Blutgefäß-Nerven-Bündel innerhalb des umliegenden Gewebes. Dann
wird das Blutgefäß-Nerven-Bündel zusammen mit dem Kopfwendemuskel zur Seite
verlagert, um Verletzungen dieser Strukturen während der eigentlichen Operation
zu vermeiden. Aus dem gleichen Grund wird die mittig gelegene Schilddrüse auf
die Seite verlagert.
|
Verwendung chirurgischer Haken
|
Eine Verlagerung anatomischer Strukturen wird meistens so durchgeführt, dass ein
Operationsassistent diese vorsichtig unter einen chirurgischen Haken nimmt und
aus dem Operationsgebiet heraus hält (ein chirurgischer Haken ist nicht spitz,
sondern er entspricht eher einer abgerundeten und in rechtem Winkel gebogenen
Metallplatte). Auf diese Weise hat der Chirurg freie Sicht auf das
Operationsgebiet, und verletzungsgefährdete anatomische Strukturen werden
geschont.
|
Vordringen bis zum vorderen Längsband der HWS
|
Im nächsten Operationsschritt wird nun auch die mittlere Halsfaszie
durchtrennt. Mit dem nun folgenden stumpfen Vorgehen erreicht der Operateur
schließlich die Halswirbelsäule, und zwar zunächst das vordere Längsband. Das
vordere Längsband ist eine kräftige Bandstruktur aus Bindegewebe, die entlang
der gesamten Vorderseite der Wirbelsäule verläuft. Es stabilisiert die
Wirbelsäule und grenzt sie gegenüber den Halsweichteilen sowie dem Brust-,
Bauch- und Beckenraum ab (vgl.:
Aufbau der Wirbelsäule). Mitunter ist es erforderlich, die untere
Schilddrüsenschlagader (Arteria thyroidea inferior) abzubinden und zu
durchtrennen, wenn diese in ihrem Verlauf das Operationsgebiet kreuzt. Nun ist
die Wirbelsäule zugänglich und kann entsprechend der Ausdehnung der geplanten
Operation freigelegt werden.
|
|
Versorgung der Halswirbelsäulenverletzung
|
Entfernung von Knochenstücken und verletzten Bandscheiben
|
Die eigentliche Versorgung der Halswirbelsäulenverletzung beginnt damit,
Knochenfragmente und verletzte Bandscheiben zu entfernen. Dazu verwendet der
Operateur Fasszangen, die in unterschiedlichen Größen zur Verfügung stehen. Bei
der Fragmententfernung muss sorgfältig darauf geachtet werden, dass sich keine
Knochensplitter und kein Bandscheibengewebe nach hinten, in Richtung des
Rückenmarks schiebt, um dieses nicht zu komprimieren. Gerade bei sehr kleinen
Knochensplittern ist der Einsatz eines Operationsmikroskops hilfreich.
|
Einsetzen eines Knochenspans
|
Durch die Entfernung von Knochenfragmenten und Bandscheiben entsteht in der
Halswirbelsäule eine Lücke, die überbrückt werden muss. Eine Lückenschluss ist
auf 2 verschiedene Arten möglich:
- Einsetzen eines Knochenspans
- Verwendung eines sogenannten Cages
Ein Knochenspan wird meist aus dem Beckenkamm des Patienten gewonnen.
Dazu wird der Beckenkamm freigelegt und ein Knochenstück der benötigten Größe
herausgesägt. Der auf diese Weise entstandene Knochendefekt im Beckenkamm lässt
sich gut mit Kollagen auffüllen. Der Knochenspan kann dann auf dem
Operationstisch auf die exakt passende Größe gebracht werden. Nach dem Einsetzen
des Knochenspans kommt es im Laufe der Zeit zu einer Verwachsung mit den
benachbarten Wirbelkörpern, sodass die Halswirbelsäule wieder stabil wird.
|
Einsetzen eines Cages
|
Bei einem Cage handelt es sich um einen "Lückenfüller" aus
beispielsweise Polyetheretherketon (PEEK), Keramik, Karbon oder Titan.
Insbesondere Titan-Cages können bezüglich ihrer Ausdehnung sehr genau auf die zu
füllende Lücke angepasst werden. In ihrem Inneren weisen Cages einen Hohlraum
auf. Dieser wird vor dem Einsetzen des Cages entweder mit patienteneigenem
Knochenmaterial oder mit Kalziumphosphat gefüllt. Auf diese Weise können die
benachbarten Wirbel im Verlauf einiger Wochen eine feste Verbindung mit dem
"Lückenfüller" (beziehungsweise mit dem darin enthaltenen Knochen- oder
Kalziumphosphatmaterial) eingehen, und die Halswirbelsäule wird wieder stabil.
|
Fixierung mit Metallplatten
|
Sowohl ein Knochenspan als auch ein Cage kann zur Gewährleistung einer
sicheren Platzierung zusätzlich mit einer oder mehreren Metallplatten und dazu
passenden Schrauben fixiert werden. Die Verankerung der Schrauben sollte in
gesunden, nicht verletzten Wirbelkörpern erfolgen.
|
Stabilisierung führt zur Versteifung der HWS
|
Das Einsetzen eines Knochenspans oder eines Cages stabilisiert die
Halswirbelsäule, schränkt deren Beweglichkeit im Vergleich zu einer gesunden
Halswirbelsäule jedoch ein. Das ist darauf zurückzuführen, dass es durch das
Einsetzen des Knochenspans oder des Cages zu einem Verwachsen mehrerer
benachbarter Wirbel kommt, die nun nicht mehr gelenkig miteinander verbunden
sind (Versteifung).
|
|
|
|